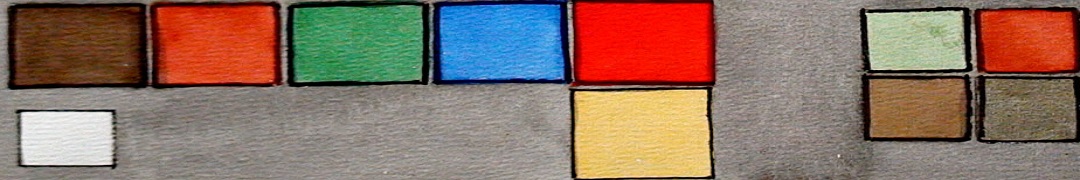Es ist Krieg
2022 – Es ist Krieg.
Es ist wieder Krieg. Eigentlich ist immer noch Krieg, seit meiner Schulzeit. Warum ist das so? Darüber denke ich seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach.
Den 2. Weltkrieg habe ich als Kind und Schüler mitgemacht. Und damit auch das NS-Regime, das wusste, wie man junge Menschen begeistern kann. Und in der Lehrerbildungsanstalt habe ich dann erleben und lernen müssen, was man von uns erwartete und wie man Elternhaus und Kirche kalt zu stellen beabsichtigte. Aus diesen Erfahrungen habe ich, nachdem ich Berichte und Filme aus den KZs und Vernichtungslagern gesehen, und Berichte von den Betroffenen und Opfern gehört und erfahren habe habe, den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung gesehen. Und ich habe konsequent die Lehren daraus gezogen. Schon ende 1945 lernte ich zwei Juden, die dem Holocaust entronnen waren am Marktplatz kennen. Jascha und Sammy waren unterwegs um Rache an uns Deutschen zu nehmen. Wir prügelten uns bei Einbruch der Dunkelheit und schieden, es war im September, bei Morgengrauen als Freunde. So lange haben wir diskutiert und uns ausgetauscht. Wir hofften, dass Krieg, Diktatur, Verfolgung und Mord künftig geächtet und Friede auf Erden als oberste Maxime sein müssten. Das hat meinen weiteren Lebensweg bestimmt. Es hat mich aber auch gezwungen, meine Jugend und meine Entwicklung in der Nazizeit zu überprüfen und dafür gradezustehen.
Wie war das gekommen. Meine Eltern hatten keinerlei Beziehung zu Nazis. Sie versuchten, mich davon fernzuhalten. Schule und Dienstpflicht und Angst vor der NS-Allmacht ließen sie verstummen, wenn ich mit den mir eingeimpften Naziparolen nachhause kam. Mit meinen Freunden war ich gerne beim Jungvolk und dann auch stolz, mit allen Insignien und Abzeichen an der Uniform der LBA mich präsentieren zu dürfen. Wir hielten uns für Elite und wurden auch so behandelt. Die Lehrzeit im Internat war hart und ging mir bis ins Mark. In zwei Jahren wurde mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich war dabei ganz allein, denn der Vater war fern. In der 3. Klasse der Volksschule schon wurden wir mit der „Judenfrage“ infiltriert, verseucht. Dazu sollten wir ein Bild zeichnen.. Ich malte zwei Bilder. Ich schäme mich heute noch dieser Bilder, auch wenn viele Juden, mit denen ich darüber sprach, mir sagten: Aber Du warst da doch noch ein Kind. Max Mannheimer, David Schuster, die Geschwister Stern und Ansbacher, um nur die wichtigsten für mich zu nennen machten wie wieder Mut.
Mir wurde klar, dass Nationalismus, Militarismus und Rassismus, aber auch Kapitalismus, Egoismus und Ausbeutung schuld sind an allen Übeln, unter denen die Menschheit, ja das Leben überhaupt leidet und dass ich daraus meine Zukunft orientieren muss. Und ich fand sie zunächst bei den Naturfreunden, denen ich schon aus der Kindheit mit den Eltern verbunden war. Gemeinsam mit der weitgehend vereinigten Linken gingen wir an die Arbeit. Nicht nur wir wollten das. Es gab viele Menschen, die an eine friedliche Welt und Gerechtigkeit glaubten. Die Geschichte seitdem habe ich aufmerksam begleitet, versucht dabei mitzuwirken und meine Meinung zu vertreten. Was ich beobachtet habe, will ich hier skizzieren.
Bestandsaufnahme heute: Wir bewegen uns am Rande oder Vorfeld des dritten Weltkriegs. Wir haben zwei Weltkriege hinter uns, die auf die gleiche Weise inszeniert wurden. Es ist möglich, dass auch ein dritter sich genauso hochschaukelt. Es ging nie um Dinge, die für die Menschen in den betroffenen Staaten wichtig waren. 1914 korrespondierten die Staatsoberhäupter – die z.T. sogar miteinander verwandt waren – und schlitterten unter führender Mitwirkung des Deutschen Kaisers in einen Krieg, in dem fast in jeder Familie aus meine3m Bekanntenkreis Menschenleben oder Existenzen vernichtet wurden. In der Inflation verloren die meisten Überlebenden ihr Hab und Gut. Die aber daraus ihren Nutzen gezogen haben, bereiteten dann den 2. Weltkrieg vor. Es sind immer wieder die gleichen Figuren, die (meist im Hintergrund) im Spiel sind. Es geht um Macht und Geld, Geschäfte und Ressourcen. Immer. Auch jetzt wieder. Die Regierenden verspielen die Zukunft – die kleinen Leute zahlen mit Arbeitslosigkeit, Hunger und Not. Das ist ihr täglich Brot. Das ist schon jetzt zu spüren und es ist erst der Anfang. Die Schuldigen an allen Konflikten haben nie ihren Kopf hingehalten. Während die Kleinen hungern, prassen die Verantwortlichen. Sie haben auch ihre Bunker für den Atomkrieg,
Es ist nicht zu fassen, wie schnell die Menschen von friedlich auf aggressiv umzupolen sind, Die Friedensarbeit vieler Jahre ist in den Dreck getreten. Nur wenige Menschen in Deutschland haben einen Krieg mitgemacht. Das waren sechs Jahre Angst, Blut und Tränen und danach Hunger, Armut und ganz langsam der Beginn einer Orientierung auf die Zukunft. Alle Kriege danach entstanden im Umfeld des Kolonialismus oder des Kapitalismus. Millionen Tote auf aller Welt und immer mehr Flüchtlinge strömen in die Länder, die ihnen Zuflucht und Hoffnung geben sollen. Bisher ging das gut, denn alle profitierten davon. Das wird auch weiter gutgehen, solange der Stellvertreterkrieg in der Ukraine bleibt. Dort herrscht indessen Herr Selenskyi, der Russland bezwingen will. Aber das ist weder Napoleon noch Hitler gelungen, dessen Armeen bis zur Wolga vordringen konnten und 25 Millionen Sowjetbürger und 6 Millionen Juden morden ließ. Dass ihm viele Ukrainer dabei halfen sollte nicht vergessen werden. An Ende dieses Konflikts werden Verhandlungen stehen. Da werden beide Seiten federn lassen. Große Teile der Ukraine werden verwüstet sein. Mit den Vereinbarungen von Minsk hätte das vermieden werden können, aber Selenskyl und seine Unterstützer wollten das nicht. Die kleinen Leute werden zahlen.
Deutschland war nach 1945 zunächst viergeteilt, dann lebten wir in der Bi-Zone, durften nur mit Genehmigung der Militärregierung reisen. Noch waren wir die Verlierer, aber die Spannungen zwischen Ost und West waren schon bald zu spüren. Wir wussten, dass wir uns wieder in die Völkergemeinschaft einleben und uns durch Friedfertigkeit und Humanität das Dabeisein verdienen müssen. Die Militärregierung erlaubte schon Anfang 1946 die Gründung von Jugendgruppen und so waren wir Naturfreunde ab Februar 46 mit Falken, FDJ, KJ, CVJM, YMCA und Pfadfindern mit Unterstützung der US-Administration auf dem Weg in eine neue Zeit. Der Jugendring wurde gegründet. Wir waren auf einem guten Weg, auch wenn wir noch hungerten.
Die Siegermächte in den beiden Kriegen bereiteten mit dem Versailler Vertrag, dem Nürnberger Prozess, die Entnazifizierung und Kriegsverbrecherprozessen einer kleinen Anzahl von Tätern wohl Probleme. Mit der „Entnazifizierung“ - die Bürger mussten auf einem Fragebogen 131 Fragen beantworten - wollten die Siegermächte etwas Vernünftiges tun, nämlich die Nazis bestrafen und diejenigen, die nicht mitmachten, schonen. Das ist auf ganzer Linie gescheitert. Mit dem Wechsel der internationalen Politik zur Konfrontation Ost-West war das bald zu Ende. Wirklich aufgearbeitet ist weder einer dieser Kriege, noch der Nationalsozialismus, mit seinem Terror, den KZs, dem Rassismus, dem Holocaust, den Massenmorden und dem Militarismus schon gar nicht. Hätte man daraus nicht etwas lernen müssen? Es wurde schon bald verniedlicht, verdrängt, verschwiegen. Ich habe die Gründung der UNO als ein Zeichen gesehen dafür, dass sich etwas ändert zum Frieden hin, aber schnell hat sich herausgestellt, dass sie auch nicht mehr wert ist als damals der Völkerbund. Da wirklich über Krieg und Frieden entscheidende Beschlüsse vom Veto eines der „Großen“ Mächte jederzeit blockiert werden können, werden[H1] diese ausgehebelt. Wir haben auf einen Weltfrieden gehofft mit einer Weltregierung als Schiedsgericht und eine Weltpolizei. Und natürlich Abrüstung und Ächtung des Krieges. Ich hatte zunächst geglaubt, dass eine Neutrale Zone in Mitteleuropa vom Nordkap mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Polen, Benelux, Schweiz und Italien die Konfrontation zwischen Ost und West zu beenden imstande wäre. Wir wurden maßlos enttäuscht. Es wurde nicht einmal diskutiert. Frieden war auch in Deutschland nur das Thema am Rande, Totengedenken an den Kriegersenkmalen, am Massengrab vor dem Hauptfriedhof wie gehabt. Aber Gedenkstätten für die Opfer des NS-Regimes haben Bürger in Eigeninitiative entwickeln und schaffen müssen, oft gegen den an- und hinhaltenden Widerstand der Gesellschaft. Dabei sollten wir die nicht vergessen, die Opfer der Linken in der Weimarer Republik - von Rosa Luxemburg bis Felix Fechenbach - es sind Hunderte, große, bedeutende Menschen, die von rechts umgebracht worden.
Von 1945 bis 1948 hungerten wir. Dann gab es plötzlich eine Währungsreform und ein Lastenausgleich sollte Gerechtigkeit bringen. Wer Grundbesitz hatte bekam einen Ausgleich seiner Verluste, der Mieter ging leer aus. Meine Eltern bekamen als Lastenausgleich für die Wohnungseinrichtung, die Werkstatt und die Vorräte 400 DM. Das reichte für einen Tisch und vier Stühle. Gerechtigkeit als Start der BRD? Millionen standen vor dem Nichts. Aber nicht für alle. Denn schon bald konnte ich sehen, dass bekannte Funktionäre oder Fachleute, die für Verwaltung oder Militärregierung brauchbar schienen, einen Platz an der Sonne bekamen. Dann folgte am 13.5.1951 das Gesetz 131. Alle Ex-Mitglieder der NSDAP konnten, sofern ihnen keine Kriegsverbrechen nachgewiesen worden waren, wieder in ihre alten Stellungen und Rechte eingewiesen werden. Was für mich noch schwerer wog, war die Behandlung der Opfer des NS-Regimes. Menschen, die für ihr Recht auf Vergeltung und Unterstützung klagten, wurden in Not und Tod getrieben. An den Stammtischen dröhnte es: Es muss endlich Schluss sein mit der Wiedergutmachung. Jeder hatte seine eigene Geschichte, geprägt vom eigenen Erleben und den Lehren, die er zog und bekam. Was ihm geschah stand meist im Vordergrund.
Wie stand es damals mit Recht und Gesetz? Das stand fest, auf dem Papier. Wer aber hatte zu entscheiden? Richter, Anwälte hatten rechtsradikale Tradition, nicht nur in Bayern, aber hier sehr gut dokumentiert von Emil Julius Gumbel in seinem Buch: „Vier Jahre politischer Mord“. Beispiel: Felix Fechenbach wurde, weil er ein Telegramm, das er in einer Zeitung veröffentlicht fand, an einen französischen Journalisten weitergegeben hat, 1923 zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, das er im Zuchthaus Ebrach verbüßen musste. Im April 1924 wurde Hitler wegen seines Putschversuchs, also wegen Hochverrat vom 9. November 1923 zu 5 Jahren Festungshaft in Landsberg verurteilt, wo er mit einem Sekretär seinen “Mein Kampf“ schreiben durfte. Beide wurden Weihnachten 1924 aus der Haft entlassen.Emil Julius Gumbel hat um 1920 politisch motivierte Morde untersucht und stellte fest: „Die Justiz ist auf dem rechten Auge blind. Mehr als 350 rechtsextremen Morden stehen rund 20 linksextreme gegenüber. Die Linken Täter bekamen Todesurteile, die Rechten im Schnitt nur vier Monate Haft.Verwaltung, Polizei, Gerichte entschieden und entscheiden immer, wie sie es gelernt haben. Und so fielen und fallen auch die Urteile bis heute aus. Justiz – wie gehabt: Die Kleinen hängt man, die großen lässt man laufen, ja sie werden sogar noch belohnt. Die kleine Diebin (sie hat gefundene Wert- Bons für sich verwendet) wird an den Pranger gestellt, verliert den Job und wird bestraft. Der Steuerhinterzieher sitzt einen Teil seiner Strafe in Edelhaft ab, muss nur einen Teil der hinterzogenen Summe begleichen und wird danach gefeiert wie ein Held. Der Beispiele gibt es viele.
Auch die Bildung wurde nach 1948, nach einer kurzen Zeit von denselben Lehrkräften vermittelt, die uns den Faschismus eingetrichtert hatten. Die Zeit zwischen 1914 und 1945 stand nicht auf dem Lehrplan unserer Kinder –und das ist bis heute so. Allenfalls als Initiative einer Lehrkraft wurde mal darüber gesprochen. Der Frage: was haben Sie damals gemacht, konnte man so vermeiden, auf allen Gebieten. Es ist nicht nur nötig, das Buch: Eugen Kogon: Der SS-Staat müsste Pflichtlektüre schon in den Volksschulen sein. Und die paar Menschen, die heute noch aus eigener Erfahrung berichten könnten, sollten dazu gerufen werden. Nicht nur in Schulen, auch im Kindergarten habe ich schon über diese Zeit erzählt und diskutiert. „Ich und der Nationalsozialismus“ ist ein eigenes schmerzliches Thema.
Und was geschah mit den Opfern des Faschismus, Nationalismus und Militarismus? Es gereicht Deutschland zur Unehre. Schon nach einigen Monaten nach dem 8.Mai 45 tummelten sich Nazis, die natürlich während des Krieges nicht an der Font standen, sondern als „Goldfasanen“ (so nannte man die ständig in ihren hellbraunen Uniformen mit den goldenen Litzen und Zeichen paradierenden Bonzen, die damals Bürger überwachenden und gängelnden Leute), im Schutz der Militärregierung auf beratenden Stellen, aber auch in einigen Parteien, voran die CSU und nach kurzer Zeit im BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, wobei sich Nazis als Entrechtete fühlten.
Sie hatten in den Kriegsjahren als Beamte in Verwaltung, Justiz, Überwachung und Verteilung die für die Neugestaltung nötigen Kenntnisse und diese wurden gebraucht. Das ging bis in die Spitzen der Besatzungszonen, später bis in die Bundesregierung. In den 50er Jahren wurden Kommunisten wie Verbrecher behandelt, Mitglieder der FDJ und Jungsozialisten wurden nicht zum Studium zugelassen, ein Lokomotivführer durfte seinen Beruf nicht ausüben. Willy Brandt und Herbert Wehner wurden im Bundestag von der vereinigten Rechten aus CSU, FDP und BHE mit negativen Namen belegt. Und manche von denen, die vor 1933 als Gegner der Nazis auftraten oder später irgendwie ins Netz gingen und ihre Status verloren oder im KZ landeten, hatten geglaubt, dass sie nun ein neues Deutschland mit aufbauen könnten, wurden bitter enttäuscht. Von Wiedergutmachung keine Spur. Jüdische deutsche Bürger, die emigrieren konnten, und Angehörige, deren Mitglieder ermordet wurden, glaubten zunächst daran, dass sie für ihre Verluste an Vermögen und Immobilien entschädigt würden, hatten auf Sand gebaut. Die Akten in den Archiven über diese Zeit von 1933 bis 1970 zeigen ein Bild ein Bild von Deutschland, das man gern vergessen möchte.
An der Talavera übten die Freunde der SS in den 50er Jahren schon wieder den Nahkampf. Und neben der alten Mainbrücke prangte das Firmenschild der NPD. Bekannte Journalisten und Politiker bekannten stolz: „Ich war dabei“. Bei der SS. Der Krieg wurde der heranwachsenden Jugend mit „Landserheftchen“ schmackhaft gemacht. Das Fernsehen bringt auch heute noch ständig Sendungen über Hitler und sein Umfeld, über KZs und alle Phasen des Faschismus. Wie es wirklich war, kann und darf man nicht zeigen. So harmlos, wie Krieg, Mord, und vor allem die Grausamkeiten in den KZs und Vernichtungslagern dargestellt werden, war das nie. Und diese Unwissenheit kann der Grund sein, dass eine große Mehrheit der Deutschen nach Waffen für die Ukraine schreit und nur wenige nach Frieden oder diplomatischem Vorgehen.
So haben wir uns das nicht vorgestellt. Und dann kam die Bundeswehr, wer baute die auf, genauso wie die Polizei und das Rechtswesen, die Erziehung und Lehre. Wir Pazifisten blieben weiter auf verlorenem Posten, wurden von hohen Repräsentanten unserer Republik als Ungeziefer oder Verfassungsfeinde beschimpft, bespuckt, getreten, verloren oft den Arbeitsplatz, durften nicht studieren. In dieser Zeit wurden die Grundlagen geschaffen für die heutige Zeit. Damals hieß es Sowjetunion, jetzt Russland. Und dass jetzt die Ukraine eine Rolle, besser diese Rolle dabei spielt, ist kein Zufall. Erinnern wir uns. Als deutsche Soldaten 1941in die Ukraine einmarschierten, wurden sie zum Teil als Befreier gesehen. Wie in Kriegsverbrecherprozessen offenbar wurde, waren Ukrainer auch in Vernichtungslagern und KZs tätig, „schlimmer als die SS“ sagten Zeugen aus, wie auch der Auschwitzkommandant Höß. Kollaborateure und SS-Angehörige aus damals von der Wehrmacht besetzten Ländern bekamen – bekommen vielleicht heute noch - Renten dafür. Den Opfern der Nazis z.B. in Polen, Griechenland, ja in fast allen Staaten Europa, die als Arbeitssklaven in Lagern oder KZs ausgebeutet wurden, eine Entschädigung zu zahlen wehrt sich die BRD mit allen Mitteln und Tricks. Das alles sind Indizien für die heutige Lage in der Welt. Dass dabei die BRD eine so große Rolle spielt, ist aus all diesen Fakten zu lesen und das ist besonders schockierend. Herr Selenski schreit dauernd nach Hilfe aus Deutschland. Gab es gar Absprachen über die Politik der Selenski- Regierung gegenüber den Russen in ihrem Land? Ich sehe eine Kriegshetze in den Medien, das Wort Frieden findet man viel zu selten. Die Kriegsberichte sah man zu keiner Zeit so nah und bedrückend. Damals, was sah man von Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Jemen, Syrien, Tschechoslowakei, Ungarn, Serbien, Kossowo, all die afrikanischen Staaten. Wen hat das interessiert und jetzt, bei der Ukraine ist das völlig anders. Warum? Ist es vielleicht so, dass dieser Konflikt mit Vorbedacht angestrebt wurde? Die Indizien dazu sind nicht uninteressant. Verdient an diesen Kriegen, Konflikten und Notlagen haben alle -kräftig verdient. Nur die Kleinen Leite zahlen und werden ausgebeutet wie eh und je. Auch unser Wohlstand ist damit erkauft. Wir müssen uns klar darüber sein, dass das Elend, der Hunger und der Zustand dieser unserer Welt mit dem begründet ist, was wir tun oder lassen. Wir Bürger haben es in der Hand, ob es auf dieser Welt einmal Frieden und Gerechtigkeit geben kann und wird. Vielleicht einmal, ja vielleicht. Kleine Anzeichen dazu gibt es noch nicht.
Das Christentum war einst kulturbildend und Päpste, wie auch die Bischöfe wurden gehört. Dieser Tage hat Papst Franziskus sich zu Wort gemeldet und dabei darauf hingewiesen, dass es auch eine Vorgeschichte gibt. Das wurde in Presse und Medien kaum zur Kenntnis genommen. Es passte auch nicht zu den Standpunkten der Parteien die das C zwar beibehalten, aber mit dem was Jesus und seine Jünger bewegte, habe sie absolut nichts mehr gemeinsam. Dem sind ÖDP und Linke auf jeden Fall wesentlich näher.
Für mich als überzeugtem Pazifisten waren die Remilitarisierung, der Abschuss von Willy Brandt und der Nachrüstungsbeschluss die Ursache, u.a. meinen Antrag zum Eintritt in die SPD immer wieder wegzuschmeißen. Gegen die Wiederbewaffnung haben wir uns mit der Gründung des Deutschen Zweiges der „Internationale der Kriegsdienstgegner“-Würzburg in der Sonnenstraße. 5, mit Prof. Rauhut der Öffentlichkeit vorgestellt. Hunderttausende von sog. Wehrpflichtigen konnten für Friedensdienste begeistert werden. Es gibt aber noch zu viele die das anders sehen. Meine Hoffnung, dass sich die Gewerkschaften gegen die Remilitarisierung mit einem Generalstreik wehren würden, hat mich auch ihnen entfremdet. Das war die letzte Chance, den Friedensweg zu finden.
Und heutzutage ist es genauso fahrlässig, sich bei Grünen, der FDP oder den Linken zu engagieren. Ein Pazifist hat jetzt, wo Heldentum, Waffenexport und -lieferung in Kriegsgebiete von den Massen nicht nur gebilligt werden, sondern geradezu nach Eingreifen geschrien wird, fällt es schwer, nicht zu resignieren. Dass die Christlichen Parteien am lautesten schwere Angriffswaffen für die Ukraine fordern, anstatt alles zu unterstützen, was einem Ende der Kampfhandlungen dienlich wäre, müsste eigentlich für jeden wahren Christen schrecklich sein. Aber solange Waffen gesegnet werden, anstatt sie zu Pflugscharen umzurüsten und lieber einzustimmen in das Kriegsgeheul in den Medien, ist an einen wirklichen Weltfrieden nicht zu denken.
Immer noch ein wenig Zuversicht, dass die Menschheit etwas aus der Geschichte der letzten tausend Jahre lernt und danach handelt? Ja, immer noch! Denn es gibt – nicht nur in alter Geschichte, sondern in der von mir überblickbaren Gegenwart und Vergangenheit einige Geschehnisse, die zei-gen, dass gewaltloser Widerstand durchaus siegen kann. Oder war das Ende der DDR nicht auf den Wunsch einer starken Minderheit nach Freiheit gegründet? Gandhi und seine Getreuen marschierten gegen die Salzsteuer und zugleich gegen den Kolonialismus. Sie siegten, weil sie es mit aller Kraft wollten und bereit waren, dafür alles auf eine Karte zu setzen. Sie beendeten den Kolonialismus nicht nur in ihrem Land. Unzählige Länder folgten. Genauso ist es allen Diktatoren und Herrschern oder Invasoren ergangen, die seit 1945 aus ihrem Land vertrieben wurden. Keiner dieser kleinen Kriege oder Invasionen hat den Angreifern zum Sieg verholfen. Sie mussten alle mit Ergebnissen abziehen, die sie mit Verhandlungen auf Augenhöhe spielend erreicht hätten, oder sind gar mit Schimpf und Schande vertrieben worden. Früher hatte es auch noch eine Diplomatie, und daneben eine Geheimdiplomatie gegeben. Gibt es das nicht mehr? Oder ist man gar nicht interessiert daran. Vom reinen Geschäftssinn her ist es eine einfache Rechnung: Dieser Konflikt bringt den Rüstungsindustrien einen enormen Zuwachs wahrscheinlich in Billionenhöhe. Außerdem geht’s um Riesengeschäfte mit Erdgas, Erdöl, Getreide und Verteilung auf allen Seiten. Leidtragende sind die Ukrainer und die Russen. Danach wird die Ukraine wieder aufgebaut. Da gibt es auch ganz schön was zu verdienen. Bezahlen müssen es alle kleinen Leute auf der ganzen Welt. Die Währungen wackeln, Inflation ist seit Jahren permanent. Wer Grundbesitz hat ist fein raus. Und wer ein Mandat hat, ist auch nicht chancenlos. Denn ob z.B. das deutsche Parlament reduziert wird, können sie ja selbst bestimmen, genauso wir die ständigen „Angleichungen“ der Diäten. Es gibt keine funktionierende Kontrolle, die jede Maßnahme und Ausgabe kontrolliert, die jede Überschreitung der Befugnisse, Ausgaben oder Maßnahmen sanktioniert. Gerade jetzt, in dieser Zeit von Ukrainekrieg und Corona-Hype ist es unerhört, wie mit dem von der Mehrheit der Bürger und den Menschen der Zukunft hart erarbeiteten Geld geaast wird. Da schmeißt einer 100 Milliarden hin für Waffen und Militär, als wäre das ein Butterbrot. Was hätte man davon für Arme, Kindergärten, Bildung und Gesundheit tun können. Und wen interessiert es denn, was wir einfachen Bürger sagen, meinen, wollen?
Als ich in den 80er, 90er Jahren einen Leserbrief schrieb, wurde er veröffentlicht. Heute nur wenn er passt. Damals, ja bis vor Corona bekam ich eine ausführliche Antwort von Abgeordneten, Ministern, Stadtverordneten und Räten, auch von Präsident und Verfassungsgericht. Jetzt aber findet keiner von angeschriebenen Mandatsträgern oder Leitern es für angemessen auch nur den Eingang des Schreibens zu bestätigen.
Betrachten wir die Ampelkoalition 2022, nach Corona und nun dem Ukrainedebakel. Ein Trümmerhaufen. Wie war es denn am Anfang in den 50er Jahren mit den Parteien und der Regierungsarbeit. Da gab es Debatten im Bundestag, da nahm die ganze Bevölkerung teil, saß am Radio, fieberte mit. Da kannte man die großen Redner, da konnte man sie beim Wort nehmen. Das waren Menschen aus dem Volk, es waren viele Berufe und alle Schichten des Volkes vertreten. Heute aber ist kaum etwas bekannt über Abgeordnete nach Berufen, Herkunft und Bildung. Heute sind es fast nur noch Akademiker, vor allem Juristen und Parteikarrieristen, die selbst über ihr Einkommen und ihre Zukunft entscheiden. Wer nicht mehr gewählt wird, kann sicher sein, mit einem lukrativen Posten in der Wirtschaft, im Regierungsumfeld, der Parteiführung oder Lobby untergebracht zu werden.
Schauen wir uns die Akteure dieser Zeit- an: Was ist ihr Beruf, was haben sie gelernt, wie verlief ihr Werdegang. Sind sie Fachleute? Sind ihre Berater Fachleute? Oder sind sie alle aus der Polit-Kaste. Genau. Und weil die Berater auch nichts wissen, darum wird diese Politik gemacht.
Das kann man bei der Gesetzgebung im Sozialen am deutlichsten sehen. Waren die Zuwendungen im Sozialen von Kindergeld bis Krankenversicherung früher auf Bedürftigkeit zugeschnitten, profitieren auch Millionäre und Minister – sicher noch mehr als der sogenannte „Kleine Mann“. Wir haben unsere zwei Kinder noch ohne Kindergeld in den schweren Aufbaujahren aufgezogen. Da gab es Kindergeld erst ab dem 3. Kind. Das ist nur eines von tausend Beispielen, die ich mir sparen kann. Sie haben kaum noch Kontakt zum Volk, sind eine eigene Kaste, haben keine Ahnung, wie es den Menschen dort draußen geht. Sie treffen Entscheidungen über die man nur noch den Kopf schütteln kann. Es fühlt sich an, wie ein Film, bei dem man nur Zuschauer ist.
Da gibt es unsere Verfassung, die eigentlich nur als Grundgesetz geschrieben wurde und die erst nach einer Wiedervereinigung vom ganzen deutschen Volk in einer Abstimmung bestätigt werden sollte – vom ganzen Volk. Diese Abstimmung fand nicht statt. Irgendwelche Leute sagten sich: diese Bevölkerung brauchen wir doch nicht zu fragen, das machen wir unter uns aus. Und so sagten sie: Das Grundgesetz ist Verfassung- fertig. Und in der Tat: Das Volk schläft. Mit denen kann man das ja machen.
Es ist schmerzlich, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Viele denken gar nicht erst daran, das zu tun. Andere sehen nur die eigenen Belastungen im Vordergrund. Und so ist z.B. der 16. März abends in jedem Jahr die Stunde des Gedenkens an die Zerstörung des größten Teils unserer Stadt. Das denken wir an das, was wir verloren haben, unsere Angehörigen, Freunde, unser Hab und Gut. Aber nur wenige denken daran, warum das geschah, dass man das eben auch als Folge, als Revanche für das Leid gesehen werden muss, das wir, unsere Politik, unser Staat, das verursacht hat. Und wir haben damals geschwiegen oder gar begeistert mitgemacht.
Und heute: 100 Milliarden für die Bundeswehr, bisher sind Billionen schon verjubelt worden und ständig wird nachgebessert- aber immer wieder heißt es, sie sei nicht einsatzfähig, also immer mehr für dieses Fass ohne Boden. Die ver“Scheuer“ten Millionen, die Fehlplanungen, die Milliarden für Beraterverträge schreien zum Himmel. - Mindestlohn, Renten, Sozialwohnungen, Wohnungslose, Bettler, Flaschensammler, alles eine Schande. Dazu kommt: Unsere Krankenkassen sind in Notlage, müssen das Strandgut der Politik versorgen, für die kleinen Leute: immer mehr Zuzahlungen in beträchtlicher Höhe, die Kassenbeträge werden erhöht, die Sozialversicherung wird damit überlastet. Dazu kommt Corona – aber wer im Monat 10.000 € bekommt, der spürt das nicht. Und die sind alle so weit von uns kleinen Leuten weg, haben keine Ahnung wie das ist: immer weniger Geld zur Verfügung zu haben, wenn die Miete bezahlt ist und die Heizung und die Kartoffeln und nicht mehr genug für ein Stück Fleisch, weil die Rente zu klein oder das Einkommen zu niedrig ist. Man baut ein Theater für hundert Millionen und ein großer Teil der Bevölkerung wird es sich nicht leisten können da reinzugehen. Für sie bleibt das verordnete und zwangsweise bezahlte Fernsehen, wo man von früh bis spät gefüttert wird mit Mord und Totschlag, Quiz und Palaver, aber sorgsam alles vermieden wird, was ein wenig von dem harten Alltag ablenkt mit Lachen, Entspannung und Spaß. Und die meisten der daneben gezeigten wunderschönen Natur- und Kulturfilme werden verhunzt durch unangebrachte Musikeinspielungen und Störung der Texte. Und einst gab es für Schwerbehinderte und Bedürftige einen Rabatt bei Eintrittspreisen in Schwimmbädern und kulturellen Bereichen.
Überall sieht man Mängel. In Bildung und Lehre fehlt es an Vielfalt und Konzentration auf Erziehung zu Kompetenz und Verantwortung. Freiheit und Recht sind in höchster Gefahr, von einer entfesselten Politbürokratie nicht nur eingeschränkt, sondern verloren zu gehen. Das Recht auf Wohnung und Freizügigkeit ist für eine ständig sich erhöhende Armut für viele nicht mehr gegeben.
Durch Verlegung der Betriebsstätten vieler Firmen und Betriebe in Billigländer wird die Arbeitslosigkeit an die Sozialversicherung delegiert, die auch mit einer ständig steigenden Anzahl von Flüchtlingen zu tun hat. Und die Arbeitslosen werden zuweilen wie Sklaven behandelt.
Was hat das alles mit dem Krieg zu tun? Könnte jemand fragen. Ich sage: Alles. Schauen wir uns den Laden doch einmal an. Was ist übrig geblieben von unserer Demokratie oder gar einer „Sozialen Marktwirtschaft“, wie sie noch in den 50er Jahren geplant und zunächst gelebt war. Nicht einmal der Name. Wir träumten mal von Beteiligung der Bürger an der Gesetzgebung, von Volksentscheid und Mitwirkung. Seit Corona und nun erst recht seit dem Ukraine-Krieg ist schon der Gedanke daran ein Sakrileg. Unsere politischen Eliten reagieren, gestützt von den Medien, die wie gleichgeschaltet wirken, selbstherrlich und sicher, weil es offenbar dafür kein Korrektiv mehr gibt.
Das sieht man ganz besonders bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland, was die deutsche Außenministerin prahlerisch als Ziel signalisiert: „Das wird Russland ruinieren.“ Wahrscheinlich wird es unseren Bürgern und unserer Wirtschaft mehr schaden, als den Russen. In den Regalen der Lebensmittelläden gibt es mittlerweile viele Produkte die 20 – 50 % teurer sind als vor 4 Wochen. Was die Abschaltung des Gases, von CSU, FDP und Grünen, wenn auch nicht so schnell gefordert, in den Wohnungen und im Geldbeutel der Bürger mit niedrigem Einkommen an‑richten wird, interessiert diese Leute nicht. Aber auch die deutsche Wirtschaft wird einiges abbekommen.
Wie konnte es so weit kommen. Mit Corona wurden Bürgerrechte ausgesetzt. Das ist eigentlich schon verfassungswidrig. Was hilft sie Verfassung, wenn man sie bei Bedarf ändern kann? Wann ist der Bürger überhaupt noch gefragt. Nur noch als „Stimmvieh“, wie es mal interpretiert wurde oder gibt es noch eine Möglichkeit, sich gegen diese Entrechtung zur Wehr zu setzen? Die Medien zeichnen ein Bild, das keinerlei Opposition erkennen lässt. Wie sollen die Menschen sich ein Bild machen, wenn Alternativen nicht gezeigt werden. So ist man, zum Beispiel, ein „Putin-Versteher“, wenn man die Vorgeschichte dieses Konflikts zur Sprache bringt. Oder die andere Seite der in den Medien verbreiteten Version der Butscha-Morde, oder die Geschichte der Krim, wie sie ukrainisch wurde.
Wenn wir im kommenden Winter frieren und hungern werden, dann mit dem Wissen, dass die, die und das eingebrockt haben, es schön warm haben und ihre Feste feiern können. Wir hätten aus der Sahara Solarstrom beziehen können, das haben die Amis verhindert. Und wenn man versucht hätte, wenigstens mit Putin und Genossen zu reden, anstatt dem Schauspieler in der Ukraine die Plattform für seine Heldenrolle einzuräumen, wäre das noch lange kein Sakrileg gewesen.
Dass unsere Bundesregierung mit Corona und Ukraine auf eine harte Probe gestellt wurde, kann aber keine Ausrede sein. Fehler können immer wieder vorkommen. Aber bei SPD und Grünen ist festzustellen, dass von den vor der Wahl gezeigten Zielen und Prämissen kaum noch was übrig geblieben ist. Das aufzuzählen kann ich mir sparen.
Bis 1990 konnte man hinter den Fassaden der etablierten Parteien Richtung und Ziel erkennen. Das ist nicht mehr gegeben. Erstes Ziel scheint zu sein, an die Macht zu kommen. Dafür kann alles infrage gestellt werden. Wem kann man denn noch die früher bekannten Attribute sozial, christlich zuordnen. Allenfalls freiheitlich, das nehmen alle für sich in Anspruch, aber nicht für die Bürger, die, wie die Wahl in NRW gezeigt hat, die Bürger gerade noch zur Hälfte an die Urnen bringt. Das ist angesichts der Fülle von Vergesslichkeit, Korruption und Tricksereien, von Ausreden, Fehlern und Abstreiten von Fehlentscheidungen auch verständlich. Es gibt leider auch keine Instanz, die in der Lage und Rechtens ist, solches Gebaren anzuprangern oder gar zu sanktionieren.
Unter Corona ist uns Bürgern von der Politikkaste die Kompetenz im Berufs- und Alltagsleben nicht zugetraut, über Gesundheit und Kontakte mit anderen Menschen zu entscheiden. Ich denke, dass ich das genauso gut kann wie diese Damen und Herren da droben. Jedenfalls komme ich zu dem Eindruck, dass es diesen Leuten droben vollkommen egal ist, was wir Bürger denken oder wollen. Zur Information für den interessierten Menschen gibt es Medien, die das, was um ihn vorgeht auch konträr oder ergänzend zur „Mainstream-Wahrheit“ vorhält. Daraus kann ich mir schon ein Bild machen. Dafür gab es bis Anfang der 2000er viele Möglichkeiten. Man sagt wohl: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie hat nicht mehr viel Zeit dazu.
1989 schrieb ich
40 Jahre BRD – Totenklage oder Hoffnung
zum Jubiläum der Bundesrepublik geschrieben von Helmut Försch
es endet auf S. 9 mit diesen Zeilen:
Es hieße Eulen nach Athen tragen,
wollte man die soziale Wirklichkeit schildern,
von den Warteschlangen in den Sozialämtern,
von den Steuergeschenken für die Großverdiener,
von den erhöhten Verbrauchssteuern, die vor allem
Kinderreiche, Arbeitslose, Kleinverdiener und Rentner treffen,
von Jäger 90 und den Kindergärten,
von Steuerbefreiung für Hausangestellte und Gesundheitsreform,
von Diätenerhöhungen und Obdachlosenstatistik,
von Suchtprävention und Selbstmordrate. Jeder sieht es.
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man sagen, was geschehen müsste,
um eine zukunftssichere und humane Gesellschaft zu entwickeln.
Jeder weiß das.
Es steht im Grundgesetz,
unsere überkommenen Moralvorstellungen schreiben es vor,
die Charta der Vereinten Nationen , die Menschenrechtskonventionen
und vor allem der gesunde Menschenverstand weisen darauf hin:
Humanität, Friedensliebe, Solidarität - Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit -
Alte und ewig neue Maxime -
Rezepte zum Überleben im nächsten Jahrtausend.
Immer noch Hoffnung ? Ja - ja - ja !
Aber es ist nicht mehr viel Zeit, was zu ändern.
1945
1945
Der Werwolf im Heizungskeller
Vor der eisernen Tür des Heizungskellers in der Landwirtschaftsschule wird es laut. Undeutlich kann ich Befehle hören, die mehrfache Sicherung meiner Ersatzzelle wird knirschend entfernt, Riegel rasten aus, die rasselnden Schlüssel und die bekannten Geräusche im Schloss zeigen mir, dass ich wieder einmal Besuch bekomme. Endlich wieder mal raus aus dem Loch, denke ich mir zuerst, aber es gibt schon zu bedenken, wie sich das weiter entwickeln wird, es kann ja noch viel schlimmer kommen. Als die Tür aufgerissen wird, stehe ich schon mit hinter dem Kopf verschränkten Armen bereit, denn das kannte ich schon zur Genüge, das hässliche Geräusch, wenn die Maschinenpistole entsichert wird, wenn der GI mit dem Finger am Abzug winkt, mir den Weg weist und das komische Gefühl im Magen, wenn man dem Lauf ins Auge schaut. Und dass das Ding losgehen sollte, dafür wollte ich auf keinen Fall einen Vorwand liefern.
„Come on“, der Wink mit der Waffe hätte der verbalen Unterstützung gar nicht mehr bedurft. Auch das Tempo der Fortbewegung hatte ich schon intus. Ging ich zu langsam, spürte ich die Missbilligung an den unsanften Stößen mit der MP im Rücken, lief ich zu schnell, zeigte der GI, dass bei der Army die Munition nicht rationiert war, denn da pfiffen einem gleich ein paar blaue Bohnen um die Ohren. Dass ich jetzt, wo so viel überstanden war, und nun wegen einer Sache, die mir noch Rätsel aufgab, noch dran glauben sollte, das wollte, das musste ich vermeiden.
Diesmal ging es nicht hinauf in den ersten Stock, wo ich schon mehrmals zur Person vernommen worden war, wo ich bisher nicht erfahren konnte, was man mir und meinen Freunden vorwarf, auch nicht, ob wir verhaftet, gefangen oder interniert waren. Meine Freunde Franz, Otmar und Werner habe ich nur einmal flüchtig im Flur gesehen und schon der Versuch, mich ihnen bemerkbar zu machen, brachte mir ein paar Stöße in die Rippen ein und dass ich nun Handschellen verpasst bekam, führte ich auch darauf zurück Aber warum durften die andern frei herumspazieren und ich nicht, das beschäftigte mich sehr.
Im Hof der Landwirtschaftsschule waren eine Menge Leute die da herumstanden oder saßen, sich unterhielten oder vor sich hin starrten. Viele von ihnen kannte ich vom Sehen. Mit meinen beiden Bewachern die mich, den gefesselten 16-jährigen Burschen eskortierten, ging ich durch das Spalier dieser Menschen, von denen ich erst, als meine Einzelhaft aufgehoben war, erfuhr, wer das alles war. Ein Jeep stand schon bereit. Die Maschinenpistole fungierte als Platzanweiser. Auf der Fahrt durch die zerstörte Stadt hielten sie häufig an, um sich mit anderen Soldaten zu unterhalten. Mein Englisch war nicht weltbewegend und die amerikanische Abart gab mir erst recht Rätsel auf. Ein paar Brocken konnte ich verstehen und was ich hörte, war erstaunlich. Die hielten mich für irgend ein hohes Tier. „Gaddämm“, „Wärwolf“, „Nazileader“, „Will be shot“, das waren die immer wiederkehrenden Ausdrücke und da wurde mir schon etwas mulmig zumute. Bisher hatte ich das ganze Geschehen ziemlich gelassen gesehen, so wie ein Zuschauer ein Turnier beobachtet. Jetzt rückte ich selbst in den Mittelpunkt. Da bisher alle Versuche, selbst Fragen zu stellen, radikal unterbunden worden waren und meine Bewacher grundsätzlich nur mit dem Lauf der Waffe mit mir kommunizierten, musste ich stillhalten, bis wir endlich vor einer Villa im Leutfresserweg anhielten. Das eine war mir auf dieser Fahrt schon klar geworden, dass man mich für irgendein ganz gefährliches Subjekt hielt und dass dieser Irrtum lebensgefährlich war.
Ich wurde in ein Zimmer geführt, mein Bewacher übergab einem Offizier meine Papiere. Ich wurde in einen kleinen Raum gebracht, wo mich ein baumlanger Farbiger bewachte. Zum ersten Mal begegnete ich einem GI, der freundlich zu mir war. Und zum erstenmal bekam ich auch was zu essen. Da merkte ich erst, welchen Hunger ich hatte. Es war ja schon länger als dreißig Stunden her, seit wir am Mainufer in Margetshöchheim von einer bis an die Zähne bewaffneten Truppe umstellt und aufgefordert worden waren, uns zu ergeben. Uns blieb da wirklich nichts anderes übrig, denn zur Verteidigung hatten wir nicht mal ein Taschenmesser und außerdem waren wir ja nicht auf dem Kriegspfad. Unter Triumphgeschrei wurden wir damals auf einen Truck geladen und nach Würzburg gebracht. Das holperte und rumpelte über die trümmerübersäten Straßen. Wir saßen auf dem Boden, die GI’s standen mit dem Rücken an die hintere Bordwand gelehnt. Mich beherrschte bei der Fahrt nur ein Gedanke: „Hoffentlich geht dem bei diesem Gewackel nicht aus Versehen seine MP los.“
Erstmals bekam ich ein Coca-Cola. Zu trinken hatte ich in meinem Heizungsraum genug, denn die Wasserleitung war intakt. Wichtiger war für mich, dass sich endlich einmal bei einem Menschen eine positive Regung zeigte, ein Lächeln oder Grinsen, Freundlichkeit oder Spott, egal. Diese wohltuende Abwechslung währte nicht lange. Ein kleiner Giftzwerg mit goldenen Streifen auf den Schulterstücken kam herein, was ich noch nicht aufgegessen hatte, nahm er mir ab und warf es in den Mülleimer. Es pflanzte sich, ein kleiner Napoleon, hinter dem großen Schreibtisch auf und wieder ging die Prozedur los, Personalien, eifrig notiert und verglichen, der Akt wuchs und für Papierverbrauch war gesorgt. Schon oft habe ich mich über unsere deutsche Gründlichkeit, unseren Papierkrieg geärgert. Die Amis zeigten uns schon bald, dass man für Lappalien acht Durchschläge auf verschiedenfarbiges Papier machen kann. Neu war lediglich, dass, wenn wirklich nach einem der „Dokumente“ gesucht wurde, das in keiner Farbe aufzufinden war. Ich wurde ins nächste Zimmer weitergereicht. Dort saß mein Freund Franz, eifrig schreibend, Kontaktaufnahme war nicht möglich, wir saßen Rücken an Rücken. Ein Schriftstück wurde mir gereicht: „Schreiben sie einen chronologischen Bericht über die letzten sechs Wochen. Was sie getan haben, wo sie waren, wen sie gesehen haben, welche Befehle sie auszuführen hatten, ausführen sollten. Name und Nr. ihrer Dienststelle, ihrer Formation etc. Falsche Angaben werden strengstens bestraft.“ Und dazu bekam ich einige Blätter feinstes weißes Schreibpapier, wie ich es lange nicht mehr in Händen hatte. Schade für das schöne Papier und das auch noch mit Kopierstift beschreiben, wie barbarisch.
Also los. Obwohl ich mir schon vorstellen konnte, was die Herren Sieger von mir erwarteten, nahm ich die Aufforderung wörtlich. Wie lange ich schrieb, weiß ich nicht. Es waren Stunden und es waren viele engbeschriebene Blätter. Ich habe neben allen Erlebnissen dieser Zeit auch die Namen aller Menschen aufgeschrieben, die mir begegnet waren bis zurück zu den Lehrern und Mitschülern in der LBA. Ich hatte mich in einen lustvollen Schreibrausch geschrieben, der mich alles um mich her vergessen ließ, was in den letzten Stunden geschehen war. Von dem Giftzwerg wurde ich wieder in die Wirklichkeit zurückgerissen. Meine ersten Kurz-Memoiren blieben unvollendet. Von dem großen schwarzen Mann bekam ich noch ein Dinner- Päckchen und ein Cola mit auf den Weg. Zurück ging es zur Haft in der Friesstraße, wo uns die Ami’s eingebuchtet hatten und wo vor ihnen die Gestapo ihre Spielchen mir ihren Gefangenen getrieben haben soll.. Am nächsten Morgen wieder rauf ins Obergeschoss. Wieder Personalien und endlich Vernehmung zur Sache. Da stellte sich für mich schnell heraus, dass die Amis ganz schön reingefallen waren auf unsern Propagandaapparat. Die hatten einen Riesenbammel vor dem „Werwolf“ und mit uns glaubten sie offensichtlich ein paar ganz große Nummern eingefangen zu haben.
Eine grelle Lampe lässt mich den feisten, auf einer dicken Zigarre kauenden, blassen Mann, der mich diesmal in die Mangel nimmt, nur undeutlich hinter dem Schreibtisch erkennen. Immer wieder befragt er mich zu den kleinsten Widersprüchen in meinen Aussagen, die mir bei dem dauernden Herumreiten auf Daten unterlaufen waren. Meine ausführlichen Erzählungen im chronologischen Bericht erweisen sich nun als Bumerang. Meine Aussage, dass ich von der Organisation des Werwolf keine Ahnung hätte und dass es mit der Aussage meines Freundes Franz, dass er beim Fähnlein „Werwolf“ gewesen sei, aber eine völlig andere Bewandtnis hat, dass das Grombühler Jungvolk, der Jungstamm 1, aus zwei Fähnlein bestanden habe, nämlich Grombühl West –Fähnlein 1 mit dem Namen „Werwolf“, Grombühl Ost – Fähnlein 2 mit dem Namen „Seeräuber“ und das schon seit vielen Jahren, das will er nicht glauben, sein Hirn verweigert ihm die Verarbeitung der Fakten. Dann werde ich wieder im Keller verstaut. Mir knurrt der Magen. Ich trinke direkt aus dem Wasserhahn, das beruhigt und vertreibt den Hunger.
Gerade will ich es mir gemütlich machen auf der alten versifften Matratze, die man mir reingeschmissen hat, da werde ich wieder rausgeholt. Zwei GI’s führen mich auf die Straße, gegenüber der Schule, in der ich die letzten Jahre gelebt und gelernt habe. Ein Jeep steht bereit: Vorn der Fahrer, ich hinten zwischen den zwei Amis. Wieder durch die staubige Stadt, rüber über die Löwenbrücke, aber diesmal Zellerau? Was kommt jetzt, frage ich mich. Es geht die Zeller Straße rauf, dann beim Bauchskeller links hoch. Im Burggraben hocken ein paar Leute in der jetzt schon bekannten Stellung in der Hocke, Hände auf dem Knie, Zigarette, Kaugummi. Die Wachposten hocken auf der Mauer, die Knarre überm Knie. „Shut up“. Kein Wort, sonst knallts. Immer wieder wird einer weggeführt. Schließlich komme auch ich dran, werde hinüber geführt durch das Festungstor. In dem Zelt hinter dem Wall hockt wieder der Mensch, der mich schon gestern in der Mangel hatte. Auf einem großen Tisch sind Messkarten aufgelegt. Ich muss auf der Karte alle Stellen zeigen, wo ich mich aufgehalten habe in den letzten Wochen. Er ist nicht zufrieden. Er spricht gut deutsch, macht mir meine Lage klar. Partisanen sind vogelfrei. Nur Kooperation kann mich retten. Aber was soll ich denn gestehen. Ich hab doch alles gesagt. Wenn ich nicht endlich meine Führer und Gefolgsleute nenne, alles auspacke, wird man kurzen Prozess mit mir machen. „So, sie wollen nicht.“ Ein Wink. Die zwei Bewacher führen mich ein paar Schritte seitwärts. Hose runter, Hände gegen die Wand gedrückt. Eine Binde wird mir um den Kopf geschlungen. Ich höre deutlich das ratschen von Gewehren die durchgeladen werden. Eigenartig.. Ich beobachte das alles, als ob es mir nichts angeht. Ob es jetzt aus ist? Meine letzten Sekunden?
Dann ist plötzlich Schluss mit der Vorstellung.- Die GI’s lachen, reißen mir den Fetzen vom Kopf. „mack snell“. Ein paar Stöße zwischen die Rippen. Los geht’s. Zurück durch die Stadt. Wir kommen an in der Luxburgstraße. Wieder nichts zu essen. Aber das ist jetzt überhaupt nicht wichtig. Ich merke auf einmal, dass ich lebe. Ich zittere wie Espenlaub, kalter Schweiß. Meine ganzen Klamotten sind nass. Wieder klappern die Türen, der Schlüssel im Schloß und der Riegel. Ratschbumm. Ich bin wieder allein. Mich friert.
Es war schon spät am Abend, als ich hinunter gebracht worden war in meinen Keller, der mir inzwischen so was wie Heimat geworden ist, denn nur noch da vermag ich logisch zu denken. Lange kann ich nicht schlafen. Wie kann ich denen das begreiflich machen. Dass ich froh war, dass der Schlamassel endlich vorbei war, kann ich denen doch nicht auf die Nase binden und sähe das nicht aus, als wollte ich mich anbiedern ? Und glauben werden sie mir das sowieso nicht. Es leuchtet mir aber ein, dass wir selbst schuld daran sind, dass wir in diese Bredouille geraten sind. Das hätte leicht noch schlimmer ausgehen können. Nicht nur zum Nachdenken, auch zum Schauen habe ich nun Zeit, denn ich werde am nächsten Morgen in den Hof geführt, ein Stuhl wird mir angewiesen und ein Wachtposten achtet sorgfältig darauf, dass ich mit den anderen Gefangenen keinen Kontakt bekomme. Die stehen in Gruppen beisammen und unterhalten sich, andere spielen mit Konservendosen Fußball oder sitzen auf Bänken, liegen auf dem Rasen und lesen, haben Zeitschriften und Bücher. Auch meine Freunde hocken dort drüben. Die können sich frei bewegen. Warum ich nicht? Rätsel über Rätsel. Aus Langeweile zähle ich die Flugzeuge, die über uns hinwegfliegen und ich mache für jedes einen Strich in den Staub. Der Wachtposten verwischt meine Zählhilfe mit den Stiefeln und bedeutet mir mit seiner Waffe, dass ich solches zu unterlassen habe. Was haben die Amis nur für einen Affen an mir gefressen. Das wird mir auch nicht klar, als ich die letzte Woche noch mal Revue passieren lasse.
Intermezzo
Am 27. März habe ich meine Mutter mit meinen jüngeren Brüdern in der Hütte am Edelmannswald gefunden. Wir waren total ausgebombt. Mit über 40 Wanderfreunden die auch aus der Stadt geflohen waren, haben sie sich notdürftig eingerichtet in dem Haus mit einer Küche, einem Aufenthaltsraum und zwei Schlafräumen. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist schwierig, denn wenn man schon etwas legal erwerben kann, muss es erst kilometerweit hinauf zum Kalten Brunnen geschleppt werden. Doch wann wird schon was aufgerufen und wenn, kommen wir zu spät, denn dort draußen am Edelmannswald bekommt man keine Nachrichten, auch die Wurfzettel der Militärregierung und dann der deutschen Verwaltung verirren sich nicht zu uns. An Hilfe von irgend welchen Hilfsorganisationen ist nicht zu denken. Es sind ja fast ausschließlich Frauen und Kinder, die dort draußen untergeschlüpft sind.
Ich hatte Weisung gehabt, mich beim Wehrbezirkskommando zu melden, habe aber in den ersten Tagen keine Anstalten gemacht, das zu tun, es gab ja viel zu tun. Die Angst der zwei älteren Männer vor den Streifen des Heldenklau bewogen mich schließlich, mit meinem Freund Franz loszuziehen. Wir waren auf dem Weg, wollten entlang des Mains nach Würzburg wandern, konnten da aber nicht weiter, erkletterten den Bahndamm, um quer durch den Rangierbahnhof über die Gleise zur Veitshöchheimerstraße zu kommen. Wir waren mittendrin, als sich aus Richtung Karlstadt eine große Anzahl von Flugzeugen näherte. Ich konnte genau sehen, wie die Bomben aus den Flugzeugschächten fielen, sagte: „Franz, pass auf, gleich knallt’s“ und dann war die Hölle los. Wir schmissen uns zwischen die Gleise, Schotter prasselte auf uns herunter, zum Glück wurde das meiste von dem Güterwaggon abgehalten. Weit drunten aus Richtung Karlstadt konnte man die nächste Welle anfliegen sehen, wir suchten also schnell das Weite, kurz vor der steilen Böschung zur Straße angekommen, rauschte der zweite Teppich herunter, hinter einem Waggon mit Tigerpanzer- Rohlingen fanden wir Deckung, die Schottersteine verdunkelten den Himmel und regneten schmerzhaft herunter. Unterhalb der Rebzucht kletterten wir den Hang hoch und überquerten die Straße, auf der vorher eine Militärkolonne mit bespannten Fahrzeugen unterwegs gewesen war und wo jetzt das Chaos herrschte. Zwischen zertrümmerten Wagen und Gerät, zerfetzte und in ihrer Not schreiende Pferde, in die Höhe starrende Knochen und Beine, Blut und Rauch, den Berg hinauf flüchtende Soldaten. Während hinter uns die nächsten Wellen anbrandeten, rannten wir den Berg hoch. Hinter uns, da wo wir noch vor wenigen Augenblicken gelegen hatten, rauschte die nächste Ladung herunter, schossen Fontänen hoch, Schienen ragten in die Luft, wieder wurden wir vom Schotterregen eingeholt. Die flüchtenden Landser hatten alles weggeschmissen, Gasmasken, Gewehre, Tornister flogen herum. Ich setzte mir einen Stahlhelm auf und schon kam die nächste Welle.
Der Rangierbahnhof wurde regelrecht aufgerollt. Wir haben nur deshalb eine Chance gehabt, raus zu kommen, weil die erste Welle am Bahnhof Veitshöchheim begann und jede Staffel, die im gleichen Abstand von Karlstadt her anflog seinen Bombenteppich anschließend platzierte. Nun sahen wir aus halber Höhe wie der Rangierbahnhof, bis hin zur Zeller Brücke umgepflügt wurde Was die Amis da fabrizierten war absolut sinnlos. Zwei Tage später waren sie da und hätten intakte Verkehrswege brauchen können. Weil ich wusste, was Soldaten auszubaden haben, wenn sie ihre „Braut“ verlieren, haben wir die Gewehre aufgesammelt und den Soldaten nachgetragen. Die sagten uns: „Mensch, verzieht euch, sonst kommt ihr auch noch dran.“ Trotzdem versuchten wir noch, nach Würzburg zu gelangen, wenigstens pro forma, denn das WBK würde ich mit Sicherheit meiden Über Rossberg und Pfaffenberg bewegten wir uns in Richtung Unterdürrbach. Da nahm uns ein Tiefflieger – eine Lightning – aufs Korn. Warum denn uns beide? Auf dem Berg waren unzählige Soldaten, deren Tross auf der Hauptstraße aufgerieben worden war. Wahrscheinlich haben die Feldgrauen sich gut getarnt und wir liefen in kurzen Hosen und hellen Hemden durch die Gegend. Und wieder war uns das Glück hold. Wir bewegten uns auf dem Weinbergsweg, direkt in einer leichten Kurve mit Weinbergsmauern auf beiden Seiten und einer kleinen Weinbergshütte an der Hangseite. Die Splitterbomben fetzten dahinter. Als sie mit ihren Bordwaffen loshämmerten konnten wir den toten Winkel in der Kurve nutzen, dann sprangen wir in die Weinbergshütte, beim zweiten Anflug flogen uns noch mal die Geschosse um die Ohren, dann drehte er ab. Wenn man zweimal so ein Glück gehabt hat, soll man das Schicksal nicht herausfordern. Wir sind nicht weiter nach Unterdürrbach gegangen, da hätten wir auch noch erwischt werden können und auch nicht nach Würzburg, wo sie um diese Zeit die Zellerau vollends fertig gemacht haben. Auf dem Heimweg konnten wir die Panzer auf der „Hettschter Höhe“ pflügen und die Mündungsfeuer blitzen sehen, als sie die Verpflegungslager zwischen Main und Bahnkörper in Brand geschossen haben.
Auf unseren Streifzügen haben wir beobachtet, dass die Leute alles, was sie brauchen konnten, aus den zertrümmerten Waggons holen. Also machen auch wir uns auf den Weg. Am Bahnhof in Veitshöchheim requirieren wir einen zweirädrigen Brückenwagen und holen uns aus den Waggons ein paar Klamotten. Da sehen wir, dass unten in den Verpflegungslagern unzählige Menschen schleppen, was sie tragen können, da ist nicht nur ganz Veitshöchheim auf den Beinen, die kommen auch von weiter her. Und da finden wir alles, was wir zum Teil nur noch vom Hörensagen kennen: Schokolade, Butter in 20 Kilo-Kartons, Käseräder, Fleisch und Wurst in Dosen. In einem brennenden Silo steht das Speiseöl knöcheltief und von oben tropft brennender Zucker herunter. Wir haben unsern „Wagen voll gelade“. Ein ganzes Rad Emmentaler können wir nicht schleppen. Irgendjemand hat ein Beil mit dabei. Gemeinsam gelingt es uns, das zähe Stück auseinander zu hauen. Da stehen wir nun mit unserem Wagen. Wie sollen wir den da hinauf zum Edelmannswald bringen. Schließlich haben wir das Glück, einen Bauern zu finden, der sein Fuhrwerk mit solchen Schatzen bis oben hin vollgeladen hat und uns erlaubt, uns hinten dran zu hängen. Es ist schon stockdunkel, als wir von Gadheim her die Hütte erreichen. Für einige Zeit ist für Essen gesorgt, wenigstens für die Beilagen, denn Brot und Kartoffeln haben wir nicht gefunden.
Am 1.April haben wir die Tafel mit der Silberdistel, dem Zeichen des Fränkischen Albvereins über der Eingangstür der Hütte abgenommen und darunter war die ganze Zeit über das Emblem der Naturfreunde, die verschlungenen Hände mit den Alpenrosen und der Gruß „Berg frei“ verborgen geblieben. Damit ist für uns der Touristenverein „Die Naturfreunde“ wieder geboren, auch wenn noch mehr als ein Jahr vergehen wird, bis von der Militärregierung die Lizenz zur Wiedergründung erteilt wird. Die von der Besatzungsmacht eingesetzte Zivilverwaltung hat die Adresse: Naturfreundehaus, Oberdürrbach 45 akzeptiert. Wir sind wieder daheim, das Haus gehört wieder uns, den Naturfreunden. Wir Buben haben dafür gesorgt, dass, während der Krieg über uns hinweg rollte, wieder einigermaßen erträgliche Zeiten angebrochen sind, die Versorgung der dort zusammen gepferchten Freunde gesichert ist, dass keiner hungern und frieren muss. Die Vorräte sind aber schnell aufgebraucht, die Väter noch in Gefangenschaft, Briefe werden nicht befördert, es gibt kein Geld und die Läden, so überhaupt welche geöffnet sind, anscheinend leer. Das Zusammenleben so vieler Menschen auf kleinstem Raum hat sich, durch das gemeinsame Schicksal genötigt, schnell eingespielt. Eine Gemeinschaft, aus der Tradition der Arbeiterbewegung und der Not geboren, bewährt sich jetzt wieder einmal..
Hinten im Wald sind noch deutsche Soldaten mit einem Pferdelazarett. Sie versuchen, zivile Klamotten, Fahrräder, Taschen, etc. zu bekommen und sich so nach Hause durchzuschlagen, weil sie keine Lust haben, in Gefangenschaft zu geraten. Wir können ihnen nicht viel helfen, denn wir haben ja nichts. Aber mit guten Tipps können wir dienen. Ob es was genutzt hat ?
Und als dann die Amis da sind, sind wir Buben weiter unterwegs und schauen, wo wir was organisieren können. So manches fällt uns in die Hände: der Spind aus der Kaserne, ein paar Uniformteile werden zu täglicher Kleidung, so manches reißen sich die Erwachsenen unter den Nagel, wie die Werkzeuge und den Tabak, aber wir kommen über die Runden. Was mich besonders freut: Ich finde eine komplette Marineuniform mit einem Hemd, das wie ein Korsett sitzt, die elegante Latzhose mit weitem Schlag, die Jacke aus feinstem Tuch, alles wie für mich maßgeschneidert. Das ist für die nächsten Jahre mein einziger, aber bei meinen Freunden Aufsehen erregender Sonntags- Ausgeh-Anzug:: „Mensch, wo hast’n denn den her?“
Auf unseren Erkundungen bin ich auch in Weinkellereien gekommen, z.B. gegenüber den Johanniterbäck, da haben die Amis gerade ihren Sieg gefeiert. Durch einen Aufzugschacht bin ich da hinuntergekraxelt und habe mir einen der herumstehenden Ballons mit Rotwein gefüllt. Die Amis haben Löcher in die Fässer geschossen, da ist der Rotwein im Bogen rausgespritzt. Bei anderen Fässern – und die waren alle über zwei Meter hoch, haben sie den Spund heraus geschlagen, knietief stand da schon der Wein. Es waren da aber auch DP’s, Verschleppte wie Polen, Letten, Ukrainer zugange und die hatten ja an uns Deutschen einiges „gutzumachen“. Wäre mir nicht ein kohlschwarzer GI zu Hilfe gekommen, wäre ich vielleicht nicht mehr lebend aus diesem Keller herausgekommen. Als ich dort hinten im Dunkeln einen Körper mit dem Gesicht nach unten herum schwimmen sah, habe ich schnell Leine gezogen.
Zurück in die Friesstraße
Dann kam der Tag, an dem wir in der Zellerau auf die Suche nach brauchbaren Dingen gingen. In den Kasernen wurden wir schnell fündig. Bettlaken, Socken, Unterwäsche und einen kleinen Handwagen fanden wir auch und den haben wir vollgeladen. Wir waren zwischen 14 und 17 Jahre alt, noch nicht raus aus dem Alter, wo man spielt, herumalbert, nicht alles so krumm nimmt, und die bis dahin für uns unproblematische Besatzungsmacht haben wir schon gar nicht ernst genommen. Da haben wir halt auch ein paar Sachen mitgenommen, die wir gut brauchen konnten, was aber den CIC und CID zu falschen Schlüssen bringen musste. Denn wir fanden Blinkgeräte und Feldtelefone mit Induktionsmotoren und Telefondraht die Menge. Die Blinkgeräte konnten wir doch, wenn es Nacht wurde, in unserer Notunterkunft, wo nur eine Petroleumlampe für ein, zwei Stunden Licht spenden durfte (solang Petroleum da war), gut gebrauchen. Da können wir, so dachten wir uns das aus, abwechselnd die Kurbel drehen und wie hell das war und wie leicht das ging, haben wir ausprobiert. Und die Feldtelefone – mein Gott, wir waren doch kaum aus unserer Räuber- und Schanderzeit heraus, was ließ sich damit anfangen, da draußen im Wald. So haben wir ein paar von den Blinkgeräten und Feldtelefonen auf den Karren geschmissen und ein, zwei Rollen Telefondraht dazu und los ging’s, den Main entlang. O je, die Zeller Brücke war auch gesprengt, müssen wir uns halt weiter hangeln nach Margetshöchheim wo es sicher eine Fähre gibt. Aber da war auch keine in Betrieb. Da kam ein Mann auf uns zu und fragte uns, wo wir denn hinwollten und was wir da alles mit uns führten. Wir hatten keinerlei Argwohn. Er fragte uns, ob wir denn nicht schon eingezogen worden wären, ob wir bei der Hitlerjugend seien und faselte was von Werwolf und Franz sagte: „Da war ich früher mal dabei und die da, damit meinte er mich und Otmar, „des warn Seeräuber“ und der Werner, der war im Fähnlein „S“.
Der Mann, der einen Roten Stern am Revers trug, riet uns dann, doch mit einem der Schiffer, die am Ufer festgemacht hatten, zu reden, sicher würde er uns übersetzen. Wir zogen unser Wägelchen dorthin und waren gerade dabei, mit dem Schiffer darüber zu verhandeln, als wir, durch klappernde Geräusche aufmerksam gemacht, feststellen mussten, dass wir von einer Gruppe amerikanischer GI’s umzingelt waren. Sie hatten ihre Waffen entsichert und ein Maschinengewehr in Stellung gebracht. Wir wurden aufgefordert, uns zu ergeben. Wir hielten das für einen Scherz und haben lauthals gelacht. Das Lachen ist uns aber schnell vergangen.
Nun sitzen wir schon ein paar Tage in der Friesstraße. Unsere Angehörigen wissen nicht wo wir sind. Wir haben keine Möglichkeit, sie zu informieren. Das Gespräch mit dem Margetshöchheimer haben wir nicht in Verbindung gebracht mit unserer Verhaftung. Was der Werwolf ist, oder besser sein sollte, haben uns nach und nach die Amis verklickert. Nach einem der folgenden Gespräche mit dem Bleichgesicht wird meine strenge Bewachung gelockert. Ich darf mich aus dem Bücherschrank bedienen und bekomme regelmäßig Essen und Trinken. Da sehe ich, als ich mich frei bewegen und mit den anderen reden darf, mit wem alles ich mein Los teile. Da sind Ortsgruppen- und Kreisleiter der Partei, Goldfasanen aller Richtungen, aber nun alle grau in grau, HJ-Führer, aber auch Frauen und Mädchen. Die wollen alle wissen, warum die mit mir so ein Wesens machen. Erst hinterher, viel später ist mir klar geworden, dass der CID hinter den „Seeräubern“ eine Geheimorganisation vermutete, die den Werwolf lenkt. Mit Mr. Sega und Colonel Johnson habe ich später darüber gesprochen und sie haben meine Ansicht bestätigt.
Irgendwie ist es dem Werner, das ist der Jüngste von uns, gelungen, seine Eltern über unseren Verbleib mittels eines hinausgeschmuggelten Zettels zu informieren. Diese haben dann mit Hilfe von Bürgermeister Sittig unsere Freilassung erwirkt. Die Amis haben uns, als wir energisch nachbohrten, den Namen des Denunzianten genannt. Sie erzählten uns auch, dass er das Handwägelchen mit allem Inhalt bei der Militärregierung abgeholt hat. Wir sind ihm aufs Fell gerückt und haben ihn in seinem Hof in Margetshöchheim, in der Nähe der Waage aufgesucht. Er hat alles abgestritten, auch unsere Sachen zu haben. Der Handwagen stand im Hof. Wir haben beschlossen, ihm einen Denkzettel zu verpassen, aber wie das so ist, man macht’s dann doch nicht. Es hat mich aber diebisch gefreut, als ich hörte, dass die Amis in Veitshöchheim, eine knallharte Truppe, man unkte, es sei eine Strafkompanie, ihn so verbläut hat, dass er reif fürs Krankenhaus war. Der Grund war allerdings das Abzeichen, das er trug und auch schon uns aufgefallen war: Ein roter Stern mit Hammer und Sichel.
Doppelt ??
Ein paar Tage später stand ich am Arbeitsamt an der Schweinfurterstraße, als ein Ami- Truck voll geladen mit gefangenen Zivilisten anhielt. Einer der Männer, ich kannte ihn von der Friesstraße, rief mir zu, ich solle seine Frau benachrichtigen, sie kämen nach Hammelburg und er hielt mir ein Billett mir der Adresse entgegen. Bevor ich zugreifen konnte, zog einer der Bewacher seine Pistole und wieder hörte ich das bekannte Geräusch und diesmal knallte es auch, ich hörte das Vögelchen zwitschern. Als der Wagen weiterfuhr, flatterte der Zettel zu Boden. Ich hob ihn aber erst auf, als der Truck schon außer Sichtweite war. Seine in der Erthalstraße wohnende Gattin zeigte allerdings keinerlei Regung über meine Nachricht – wieder eine neue Erfahrung und da läuft man ein paar Kilometer hin und zurück und dafür riskiert man auch noch Kopf und Kragen.